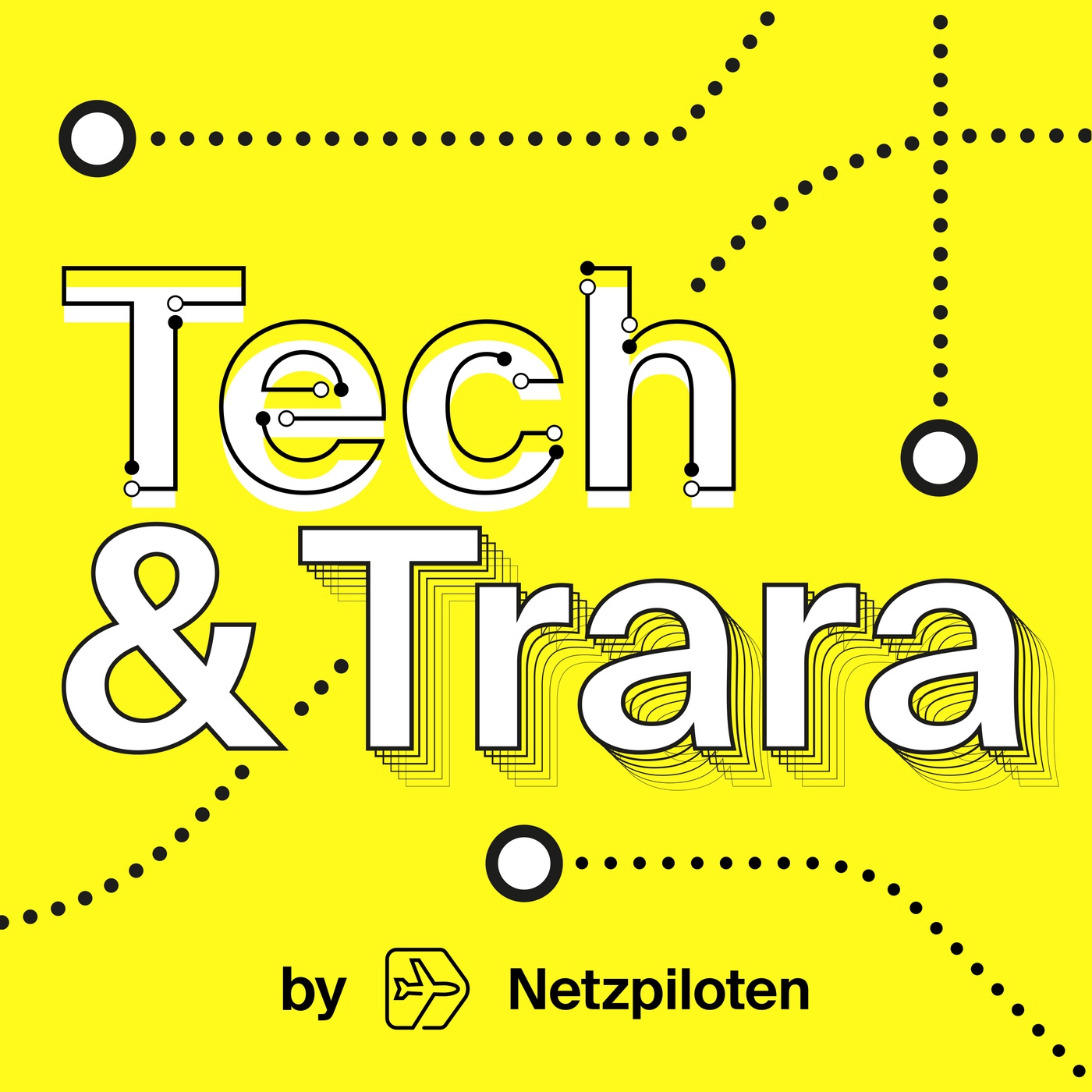
Tech und Trara
Transkript
Steffen: Am 23. Februar ist Bundestagswahl in Deutschland. Die beherrschenden Debattenthemen sind Migration, das angespannte VerhŠltnis zu den USA oder der Krieg in der Ukraine. WorŸber die wenigsten reden, ist das Thema Digitalisierung. Dabei besteht genŸgend Anlass, das Thema stŠrker in den Fokus zu rŸcken. Wie gehen wir mit den Entwicklungen um, die sich im Silicon Valley abzeichnen? Wo steht Europa? Wo steht Deutschland zum Beispiel bei den Themen wie Regulierung von KI oder auch Meinungsfreiheit versus Faktencheck? Mit welcher digitalen Agenda ziehen die Parteien in den Wahlkampf? Was wollen sie verŠndern? Wie wollen sie in Deutschland die Digitalisierung endlich voranbringen? Dieser Podcast ist eine Co-Produktion der Netzpiloten, des Common Grounds Forum und von Politik Digital. Mein Name ist Steffen Wenzel und ich mšchte diese Themen mit Oliver Bott, er ist Projektmanager fŸr das Thema Digitalisierte Gesellschaft bei der Stiftung Mercator und mit Lea Hildermeier und Marina Becker vom Common Grounds Forum diskutieren. Hallo erstmal an euch drei.
Steffen: Marina, ich habe jetzt gerade das Common Grounds Forum erwŠhnt. Kannst du einmal kurz vorstellen, was das Ÿberhaupt ist und auch noch mal ein paar Worte zu dir sagen?
Marina Becker: Das Common Grounds Forum ist eine Jugendbeteiligungsorganisation, die das Ziel hat, die Stimmen der jungen Generationen mehr in die Politik hineinzutragen. Mit diesem Hintergrund waren die Teilnehmer des Common Grounds Forum auch beim Digital-Gipfel der Bundesregierung. Mein Name ist Marina Becker. Mein Hintergrund ist technisch, ich bin also im Bereich Elektrotechnik und Informatik tŠtig. Ich habe mich dann fŸr Politik interessiert und war bei den CEPS Young Thinkers sowie beim Common Grounds Forum, um technischen Themen dort mehr Stimme zu geben.
Steffen: Lea, du engagierst dich auch beim Common Grounds Forum. Was war deine Motivation?
Lea Hildermeier: Korrekt. Ich bin Lea Hildermeier und Studentin an der Uni Bielefeld und vor allem im Fachbereich Anglistik tŠtig. Daher kommt auch die Motivation am Common Grounds Forum teilzunehmen. Auch wenn Anglistik im ersten Moment nicht so viel mit Digitalisierung zu tun hat, ist es aber trotzdem ein gro§es Steckenpferd und ein gro§er Interessenbereich von mir. Viel wichtiger ist aber noch, dass junge Menschen eine Stimme brauchen, die gehšrt wird in der Digitalpolitik Deutschlands und dafŸr ist das eine super Plattform.
Steffen: Ja, damit leitest du schon super zum Thema Ÿber. Oliver, du hast dich mit den Programmen beschŠftigt, die sich mit dem Thema Digitalpolitik beschŠftigen und kannst uns dementsprechend einen ersten †berblick geben. Was fŠllt dir auf? Was sagen die einzelnen Parteien zum Thema Digitalpolitik und Digitalisierung?
Oliver Bott: Genau, das kann ich sehr gerne machen. Es gibt da ein paar Ÿbergeordnete Beobachtungen, auf die man eingangs einmal eingehen sollte. Es gibt viel Einigkeit bei den Digitalthemen zwischen den Parteien, was etwas ganz Besonderes ist, da es bei anderen Politikfeldern, wie zum Beispiel Migration oder Klimaschutz, ganz anders ist. Du hast vorhin die Ukraine angesprochen. Da gehen die Positionen zum Teil sehr weit auseinander. Bei Digitalthemen ist es nicht so und das kann uns eigentlich Hoffnung machen. Wo sind Sie sich einig? Zum Beispiel, dass sie die Digitalisierung als ein sehr wichtiges Thema sehen. Die GrŸnen verbinden das sogar mit dem Begriff Staatsreform. Man liest auch ab und zu von Transformation. Also sagen eigentlich alle, dass es wichtig ist und mŸssen wir uns darum kŸmmern mŸssen. Es ist auch so, dass eigentlich alle Parteien sagen, dass der Kontakt zwischen BŸrgerinnen und BŸrgern und unserer šffentlichen Verwaltung einfacher werden soll. Es sollen Verantwortlichkeiten gebŸndelt werden und der Staat soll insgesamt verschlankt werden - das sagen auch alle. BŸrokratieabbau ist auch ein sehr wichtiges Thema, gerade bei der CDU und CSU. Diese Einigkeit ist nicht neu, das ist schon seit vielen Jahren so. Man fragt sich jetzt, warum es dann trotzdem so unbefriedigend ist, wenn wir AntrŠge noch per FaxgerŠt oder analog reinschicken mŸssen, obwohl sich doch alle einig sind und das auch schon seit vielen Jahren. Das Problem ist, dass es bei der Umsetzung nicht an Streitigkeiten zwischen den Parteien hakt, sondern innerhalb der Parteien. Diese Priorisierung, die nicht erst jetzt in den Wahlprogrammen angegeben wird, ist im politischen AlltagsgeschŠft nicht mehr so. Da sind dann andere Themen wie Sicherheit oder Wirtschaft wichtiger und erhalten mehr Aufmerksamkeit. Das fŸhrt dazu, dass Digitalthemen auf der Agenda runterrutschen. Das mŸssen wir in Zukunft im Auge behalten, um zu schauen, ob die Parteien das jetzt durchziehen. Der erste Punkt ist also Einigkeit. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der mir aufgefallen ist. Es geht zu 95 Prozent, wenn man sich die Parteiprogramme anschaut, um die Digitalisierung der Verwaltung, darum sie effizienter, moderner und schlanker zu machen. Es geht aber nur am Rande um tatsŠchliche Digitalpolitik, also nicht um die Nutzung von digitalen Technologien durch staatliche Institutionen, sondern um die Steuerung. Was darf eigentlich Digitalisierung? Wo mŸssen wir da Leitplanken setzen? Auch da mŸssen wir aufpassen, weil es so rŸberkommt, als ob die Bedeutung der gro§en Plattformen wie Facebook, TikTok, X, Instagram - die als Ursache fŸr vieles, das aktuell bei uns schief lŠuft, wie die Polarisierung oder das Erstarken der Rechten gelten - nicht so richtig erkannt wird. Das mŸssen wir im Auge behalten und das erkennt man an dem blinden Fleck, wenn es um mšgliche Risiken vom Einsatz von kŸnstlicher Intelligenz geht. †ber kŸnstliche Intelligenz sagen eigentlich alle Parteien, dass wir mehr davon brauchen. Wir mšchten unsere Behšrden auch gerne mit KI ausrŸsten. Das ist bei der Union so, das ist bei der SPD so, bei den GrŸnen, also eigentlich durch die Bank weg. Aber Ÿber die Risiken und den Umgang, was das eigentlich auch im VerhŠltnis zu den BŸrgerinnen und BŸrgern bedeutet, das steht da relativ wenig. Das sind Aspekte, die man auf jeden Fall im Auge behalten muss. Der dritte Punkt ist, dass man viel Symbolpolitik sieht, was fŸr ein Wahlprogramm jetzt nicht Ÿberraschend ist. Allerdings bekommt man das GefŸhl, dass das zugrundeliegende Probleme Ÿberhaupt nicht adressiert werden. Das ist schwierig, weil es mittelfristig bis langfristig zu EnttŠuschung fŸhren wird. Als Beispiel sagen alle Parteien, dass auch sie Personal abbauen mšchten und dass die BŸrokratie kleiner werden soll. Die CDU und CSU sagt 10 Prozent weniger. Eigentlich kšnnen sie jetzt schon sagen, dass das auch funktionieren wird, weil allein der demographische Wandel dazu fŸhrt, dass in den nŠchsten Jahren 1,4 Millionen Menschen, der 5,3 Millionen, die in Deutschland in der šffentlichen Verwaltung arbeiten und jetzt Ÿber 55 Jahre sind, in den nŠchsten Jahren ausscheiden werden. Die eigentlichen Probleme sind also, wie wir diese WeggŠnge auffangen kšnnen, wie wir das Wissen in der Verwaltung halten kšnnen, wie wir auf der anderen Seite kompetente und gute Leute, die sich auch beim Thema Digitales auskennen, reinbringen. Und das ist in einer Zeit, in der nur 21 Prozent, die in der Verwaltung arbeiten, ihren Arbeitgeber weiterempfehlen wŸrden, ein ziemliches Problem. Das findet man aber nicht in den Wahlprogrammen, weil es strukturelle Probleme sind, an die sich die letzten Regierungen nicht so richtig ran getraut haben - das ist ein Problem.
Steffen: Oliver, vielen Dank erstmal fŸr diese erste EinschŠtzung. Mir fŠllt natŸrlich auf, dass diese AnsŠtze teilweise die gleichen innerhalb der Parteien sind, aber doch unterschiedlich, wenn es darum geht, wer das ganze steuert. Die FDP sagt zum Beispiel, dass wir ein Digitalministerium brauchen. Die anderen sagen, dass wir eine vertikale Struktur Ÿber alle Ministerien brauchen, so wie es momentan auch ist. Die CDU und CSU sagen wieder auf Staatsminister-Ebene, so wie wir es mit Dorothee BŠr hatten, also im Bundeskanzleramt angesiedelt. Kann das einen Impact haben, wenn wir diese Regulierungsfrage mehr in den Mittelpunkt stellen? Wenn wir auch Menschen dahinter sehen, die sagen, dass sie das ganze jetzt mal selbst in die Hand nehmen und es so gemacht wird, wie wir uns das vorstellen?
Oliver Bott: Zu der Frage, wie die Parteien dazu stehen, hast du Recht. Die FDP, die Union und die Sozialdemokraten, Ÿbrigens auch die Volt-Partei, sagen alle, dass wir das Digitalministerium brauchen. Die GrŸnen sagen, dass wir das bŸndeln mŸssen, aber nennen es jetzt nicht so. Sie sind da also ein bisschen offener, wenn es um die Lšsung geht. Auch da ist die Crux. Es ist schšn zu sehen, dass das Thema, obwohl es selten vorkommt, anscheinend so wichtig ist, dass man sagt, dass wir ein neues Ministerium grŸnden mŸssen. Wenn wir allerdings mal ins internationale Ausland schauen gibt es andere LŠnder, wie Finnland, Norwegen, Schweden oder Estland, die bei der Digitalisierung relativ gut dabei sind und da findet man jetzt kein Digitalministerium. Es zirkulieren aktuell auch viele Papiere von Think Tanks, wie zum Beispiel Agora digitale Transformation oder auch dem Digitalpolitischen BŸndnis F5, die sagen, dass es politische Aufmerksamkeit, ein klares politisches Mandat, eine klare Strategie, ein zentrales Budget und kompetente Menschen braucht, die das auch umsetzen kšnnen. Das wird sich zeigen. Ich gehe relativ stark davon aus, dass tatsŠchlich ein Digitalministerium kommen wird. Da sind wir dann wieder bei den Strukturen, an die man so ungern rangeht, weil es so viel Arbeit ist, so lange dauert und auch politisch bei den WŠhler-Innen nicht so richtig gedankt wird, weil man darŸber in den Zeitungen nicht so gerne liest - es ist halt abstrakt und ein langweiliges Thema, was wir bedenken mŸssen. Wenn das Ministerium kommen sollte, dann wird es realistischerweise wahrscheinlich mindestens ein, eher anderthalb Jahre oder sogar noch lŠnger brauchen, bis es seine Arbeit richtig aufnehmen kann. Was passiert bis dahin? Das wird sehr spannend zu sehen. Aber ja, viele gehen davon aus, dass das Ministerium kommt.
Steffen: Ob es dann besser wird, wird sich dann zeigen. Lea, du hast bestimmt auch Erwartungen und siehst auch den Gap zwischen dem Thema. Es ist zwar ein wichtiges Thema, findet aber in der …ffentlichkeit nicht statt. Wie kšnnte man das verŠndern? Was sind deine Forderungen?
Lea Hildermeier: Ja, ich mache nochmal die Flughšhe ein bisschen hšher und gehe auf das ein, was Oliver am Anfang schon analysiert hat, also was die Parteien eigentlich ausmachen. Es geht oft um Innovation und wirtschaftliche Lšsungen, weniger um soziale Bildungshaltung, die vielleicht auch dahintersteht und die Frage, wie wir verschiedene Menschen mit einbeziehen kšnnen, wenn es um Digitalpolitik geht. Also was passiert Ÿberhaupt auf der strukturellen Ebene, die sich dahinter versteckt? Das sind zwei Punkte, die ganz eng miteinander zu tun haben und die, glaube ich nicht nur mich beschŠftigen, sondern auch das Common Grounds Forum. Ich wŸnsche mir, dass der Einbezug junger Menschen stŠrker wird. Nur so kšnnen wir sicherstellen, dass die Anforderungen, €ngste und Kompetenzen junger Menschen wahrgenommen werden. Das fŸhrt uns auch zum demographischen Wandel und der Frage, wer diesen Job in der Zukunft macht. Das hei§t, die Antwort auf die Frage ist vor allem, dass es mehr strukturellen Einbezug diverser Meinungen und vor allem auch mehr Einbezug junger Stimmen in diesem Diskurs braucht.
Steffen: Da kšnnte man natŸrlich auch sagen, dass man in eine Partei gehen kann, um das umzusetzen und nicht immer in der au§erparlamentarischen Opposition oder in der Zivilgesellschaft arbeitet. Ist das eine Lšsung oder wŠre das ein bisschen zu komplex?
Lea Hildermeier: Ich wŸrde sagen, teils teils. Ich glaube, dass man eine individuelle Antwort fŸr sich finden muss. Wenn ich spezifisch auf den Bereich Jugendbeteiligung gucke, muss die Antwort nicht immer direkt einen Parteibezug oder Parteiarbeit nachfolgen lassen. Das kann gut gelingen, muss es aber nicht. Ich glaube, dass es in den Bereichen, in denen junge Menschen bereits unterwegs sind, also an ihren Schulen, UniversitŠten und Vereinen ganz viel auf einer Multiplikator-Innen-Ebene funktioniert, um da fŸr sich aktiv zu werden. Wir erleben ja auch, dass gerade junge Politikerinnen massiv Hass im Netz erleben, wenn sie aktiv werden. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, womit junge Menschen schnell konfrontiert werden. Das hei§t, dass es auch da andere Wege geben kann, aktiv zu werden.
Steffen: Das ist ein wichtiges Thema, also auch die Angst davor, dann in den Mittelpunkt zu geraten, beziehungsweise auch angegriffen zu werden. Marina, was sind die Themen, wenn du jetzt so die Zusammenfassung von Oliver hšrst, die dich am meisten interessieren und was fehlt dir in der ersten Zusammenfassung?
Marina Becker: Also das ist eine gute Frage. Erstmal fand ich es sehr interessant, dass es mit dem Digitalministerium keine Differenzen gibt. FŸr mich wŠre es gut, wenn technische Sachen wirklich mal schnell funktionieren wŸrden. Da wŠre ich sehr froh. Vieles, was in den Programmen steht, bleibt letztlich Symbolpolitik ohne gro§en Effekt. Das ist besonders problematisch im Bereich KI, denn diese Technologie entwickelt sich rasant und hat enorme Auswirkungen. Gleichzeitig bringt sie erhebliche Risiken mit sich, insbesondere im politischen Bereich, etwa durch Desinformation. Daher ist es entscheidend, dass an vielen Stellen nachgebessert wird. UnabhŠngig von der Partei braucht es detaillierte und umsetzbare PlŠne, die tatsŠchlich in die Praxis umgesetzt werden kšnnen.
Steffen: Du beschŠftigst dich ja in deinem Studium mit KI oder hast auch einen technischen Hintergrund dazu. Findest du, dass es da zu viel Regulierung in Deutschland oder in Europa gibt und dass es ein Problem ist, weshalb wir nicht vorankommen? Wird zu wenig Ÿber die Folgen von KI geredet?
Marina Becker: Das ist ein schwieriges Thema. Ich bin kein Jurist, deswegen kann ich das jetzt nicht im Detail sagen. Ich sehe, dass es in vielen Bereichen immer noch kritisch ist, dass in anderen LŠndern KI in Bereichen eingesetzt wird, wo dadurch Probleme entstehen. Das kennen wir zum Beispiel bei Gemini, dass das dann erst umgesetzt wird. Wenn die User dann merken, dass da Dinge passieren, die nicht so gut sind und es daraufhin melden, wird dann noch mal nachgebessert, was natŸrlich nicht in allen Bereichen ideal ist. Wenn man sich das World Economic Forum und die globalen Risiken anschaut, gerade hinsichtlich Desinformation und KI-Risiken, zeigt sich, dass diese in den nŠchsten Jahren steigen und haben eine extrem hohe Relevanz haben. Und ich denke gerade dort sollte geschaut werden, was wichtig ist zu regulieren. Der AI-Act in Europa ist natŸrlich ein guter Schritt. Ich glaube, dass Europa und gerade auch Deutschland aufpassen mŸssen, dass man nicht so stark reguliert, dass man dann nicht mehr wettbewerbsfŠhig ist. Das ist ein sehr komplexes Thema. Ich persšnlich habe auch keine finale Meinung dazu. Und ich glaube, dass es super viele Aspekte zu bedenken gibt, es aber auch sehr interessant fŸr die Zukunft ist.
Steffen: Danke dir fŸr die erste EinschŠtzung. Oliver, was denkst du? Haben wir so eine Stellvertreterdiskussion darŸber, dass sowieso alles in der EU entschieden wird und wir in Deutschland gar nichts mehr machen kšnnen Ð sprich beim AI-Act, der GSA oder dem Digital Service Act? Oder haben wir in Deutschland noch Gestaltungsspielraum als kŸnftige Bundesregierung und wird diese dann auch richtig wahrgenommen? Was denkst du?
Oliver Bott: Ich glaube, wir haben Gestaltungsspielraum und den mŸssen wir auch aktiv nutzen. Also ich glaube, dass gerade an diesen Beispielen, wie der AI-Act oder die KI-Verordnung auf der einen Seite und der Digital Services Act auf europŠischer Ebene, eigentlich kein Weg vorbei fŸhrt. Wenn wir als einzelnes Land global gesehen ohne die EU agieren wŸrden, dann wŠren wir viel mehr Spielball von den Big-Tech-Konzernen aus den USA und aus China. Man muss einfach sehen, dass wir auf europŠischer Ebene zusammenhalten und zusammen entscheiden, wenn uns demokratische Rechte und Werte wichtig sind. Wenn wir die Anforderungen formulieren, mŸssen sich diese Werte auch in den Technologien widerspiegeln, die wir nutzen. Wenn wir das tatsŠchlich ernst meinen, dann geht es eigentlich gar nicht anders. Und zu dieser Diskussion Ÿber Innovation oder Regulierung, ist ein gro§er Trugschluss, vor allem auch in den šffentlichen Debatten, dass das eine das andere ausschlie§t. Ich glaube, dass wir stattdessen sogar einen USP, einen Unique Selling Point in Europa haben, wenn wir sagen kšnnen, dass es bei uns Technologie, die tatsŠchlich den Menschen hilft - die nicht spaltet und die mehr Partizipation sowie mehr Teilhabe ermšglicht. Im Idealfall fŸhren wir dort auch GesprŠche mit politischen EntscheiderInnen wie in den USA. Das war mit der alten Regierung so, mal schauen, wie offen jetzt die neue sein wird. Die schauen natŸrlich auch nach Europa und sagen, dass es irre ist, was da geschafft wurde, denn in den USA erzŠhlen die Konzerne, dass sie das alles nicht machen kšnnen, was sie jetzt einfordern. Im Grunde genommen sehen sie jetzt, dass man es doch einfordern kann. Von daher ist das dieser viel beschworene BrŸssel-Effekt, dass das, was wir in Europa entscheiden und auch durch Regulierung festlegen, hoffentlich auch auf andere LŠnder abfŠrbt - das wŠre eine gro§e Chance.
Steffen: Aber es ist ja gerade das Gegenteil der Fall. Wenn man die letzte Rede von Zuckerberg hšrt, hei§t es ja ganz deutlich, dass wir weniger Regulierung und weniger Kontrolle wollen.
Oliver Bott: Ganz genau. Steffen (21:31:000) Wir wollen keine Hasskommentare automatisch lšschen oder von internen Teams durchforsten lassen, sondern andere Leute kšnnen das melden und dann werden wir das begutachten. Das hei§t im Endeffekt natŸrlich auch mehr Gewinn fŸr ihn, weil er weniger Leute darauf ansetzen muss. Ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen. Aber es ist natŸrlich diametral zu dem, was wir in Europa als Common Sense vereinbart haben. Das ist natŸrlich eine Gefahr, dass es auch nach Deutschland rŸber schwappt. Die AfD hat zum Beispiel in ihrem Programm die Abschaffung des Netzwerksdurchsuchungsgesetzes, also des sogenannten Facebook-Gesetzes. Das bedeutet, dass man fŸr den Content auch verantwortlich ist und regulierend eingreifen muss. Das geht ja schon genau in diese Richtung, den amerikanischen Weg einzuschlagen. Die AfD macht das natŸrlich unter dem †berthema, dem Metathema, Meinungsfreiheit.
Oliver Bott: Mhm.
Steffen: Aber ist das ein Weg, den wir in Europa durchhalten kšnnen? Wie soll sich die kŸnftige Bundesregierung deiner Meinung nach dazu positionieren? Kšnnen wir gegenŸber diesen gro§en Big-Tech-Unternehmen aus den USA bestehen, wenn wir wissen, dass es Unternehmen sind, die mittlerweile zum sozialen Leben von allen Generationen dazugehšren?
Oliver Bott: Absolut. Du stellst jetzt gerade die Frage aller Fragen. Also das ist tatsŠchlichÉ
Steffen: Die 10.000 Euro Frage.
Oliver Bott: ja mindestens mal. Es ist zumindest im digitalpolitischen …kosystem die gro§e Frage, inwieweit sich die EU oder sogar einzelne Mitgliedsstaaten unter Druck setzen lassen, um erreichte Meilensteine wieder abzuwickeln. Wenn du mich fragst, mŸssen wir unbedingt daran festhalten, sonst machen wir uns unglaubwŸrdig. Die eigentliche EffektivitŠt dieser Regulierung wird sich auch erst mit der Umsetzung zeigen. Nur weil wir ein Gesetz verabschiedet haben bedeutet das nicht, dass sich von jetzt auf gleich alles verŠndert, sondern dass Behšrden geschaffen werden mŸssen. In Deutschland ist das fŸr den DAS die Bundesnetzagentur. Die mŸssen erst mal richtig arbeiten kšnnen und genug Personal haben. Auch das ist ein kritischer Faktor. Wenn wir jetzt auf die Wahlprogramme zurŸckblicken, dann sind es zum Teil unterschiedliche Haltungen. Die FDP sagt zum Beispiel, dass wir die KIVerordnung innovationsfreundlicher gestalten mŸssen. Die wollen das direkt aufweichen. Ebenso wie die Union, die genau dasselbe sagt - innovationsoffen umsetzen, aber die KI-Verordnung bitte nicht ŸbererfŸllen. Da sehe ich die Gefahr, dass rŸckwirkend doch noch Anpassungen eingefordert werden. Die GrŸnen und die SPD sind da wesentlich konsequenter. Die GrŸnen sagen, dass sie die KI-Verordnung mšglichst unbŸrokratisch umsetzen wollen. Da ist auch schon wieder so ein kleines ãja, vielleicht kšnnen wir das doch noch mal drehenÒ, aber der DSA muss konsequent umgesetzt werden. Das sagt die SPD auch. Da wird sich zeigen, wie standhaft wir tatsŠchlich bleiben kšnnen und ich glaube da ist eine ganz gro§e Aufgabe, gerade von der Zivilgesellschaft, die politischen Entscheider-Innen dafŸr zu sensibilisieren. Es geht ja nicht darum, dass wir Regeln haben, um irgendwen zu Šrgern, sondern um uns zu schŸtzen, um unsere Grundrechte und unsere Verbraucherrechte zu schŸtzen. Da zu sagen, dass es uns jetzt doch nicht mehr so wichtig ist und dass sie ihren Hass doch online auf die Menschen ablassen sollen und Technologien einzusetzen, von denen wir Ÿberhaupt nicht wissen, wie sie eigentlich funktionieren, ist total kritisch. Zum Beispiel bei der Polizei, bei Richter-Innen oder auch im Gesundheitswesen sind es keine trivialen FŠlle - da ist es super wichtig, dass wir da den Kurs halten.
Steffen: Eine mšgliche Antwort auf diese Entwicklung, die aus den USA kommt, kšnnte ja auch sein, Europa zu stŠrken. Nicht nur durch Regulierung, das hei§t also das zu regulieren, was reinkommt, sondern selbst etwas aufzubauen. Digitale SouverŠnitŠt nennt man das, also digitale Services selbst anzubieten. Die GrŸnen haben das in ihrem Wahlprogramm stehen - die gehen darauf ein. Bei den anderen Parteien habe ich das nicht gefunden. Auch Bayern ist immer wieder ein viel diskutiertes Thema. Ich glaube, dass man es bei der FDP auch nicht finden wird. Die werden sagen, dass der Markt das schon regelt und sich die Besten durchsetzen. Siehst du da etwas in den Wahlprogrammen, was dir aufgefallen ist und denkst du, das ist ein guter Schritt, auf mehr digitale SouverŠnitŠt zu setzen?
Oliver Bott: Ich denke, dass es ein Weg ist, den wir gehen sollten. Einerseits geht es aus wirtschaftlicher Sicht darum, AbhŠngigkeiten zu reduzieren, aber auch wieder auf den Fahrersitz zu kommen, um zu entscheiden, was fŸr Technologien wir eigentlich haben wollen. Wenn es darum geht, welche Alternativen es zu X, ehemals Twitter, gibt, wŠre es natŸrlich schšn, wenn diese unsere Gesellschaft stŠrker machen Ð besonders durch die Art und Weise, wie dort der Diskurs gefŸhrt werden kann. BezŸglich der Wahlprogramme ist mir aufgefallen, dass die meisten Parteien digitale SouverŠnitŠt einfordern. Eine Ausnahme ist interessanterweise die SPD - da steht gar nichts dazu. Allerdings sind die Union, die GrŸnen und auch die FDP - auch die anderen Parteien mit Ausnahme der AfD Ð auch ein bisschen dafŸr, nationale KI zu fšrdern. Zum Beispiel fordert die CDU und CSU eine europŠische Cloud und Speicher- und RechenkapazitŠten. Eine Cloud fordern auch die GrŸnen und die Rechenzentren werden auch von der FDP gefordert. Die sagen das schon. Allerdings ist da auch das Risiko, bei den Stichpunkten, die ich genannt habe Ð Chips und Rechenzentren sind Einzelaspekte der digitalen SouverŠnitŠt. Es gibt aber eigentlich auch noch mehr. Das ist wesentlich komplexer als das. Es fŠngt an mit den Rohstoffen Ð Seltenerden zum Beispiel. 60 bis 70 Prozent der weltweiten Produktion der seltenen Erde kommen aus China. Das ist schon mal relativ schwierig. Es geht um Chips, um Netzwerke, um die Hardware und natŸrlich auch um die Cloud, wie man es in den Wahlprogrammen findet, aber es geht auch noch um die Software und um KI. Das ist sehr vielschichtig und ich habe die gro§e Sorge, dass das nicht so richtig erkannt wird und das hŠngt natŸrlich auch mit dem Thema Beschaffung zusammen. Der deutsche Staat gibt pro Jahr 500 Milliarden Euro fŸr Technologien und fŸr Dienstleistungen aus - das sind 35 Prozent der Staatsausgaben. Der Staat ist also ein sehr wichtiger Kunde, der auch sehr viel Einfluss darauf hat, was fŸr Technologien entwickelt werden und was fŸr Unternehmen bevorzugt werden. Man muss sich vor Augen fŸhren, dass 80 Prozent der in Europa genutzten Technologien importiert sind - nur 20 Prozent kommen aus Europa. 70 Prozent der grundlegenden KI-Modelle und mittlerweile wahrscheinlich sogar mehr, kommen auch au§erhalb der EU. Da muss man auch sagen, dass der politische Entscheidungsprozess nicht nur darin bestehen sollte, digitale SouverŠnitŠt einzufordern, sondern sie auch tatsŠchlich umzusetzen - das wŠre ein wichtiger Schritt. Ihr habt ja eingangs vom Digital-Gipfel der Bundesregierung im letzten November erzŠhlt - die Konferenz zu Digitalthemen der Bundesregierung. Da meinten eigentlich alle, vom CIO bis zum verantwortlichen Abteilungsleiter im Innenministerium, dass wir europŠische Unternehmen fšrdern und mehr Open Source einkaufen wollen, es aber nicht gemacht wird. Von den 13,6 Milliarden Euro, die die Bundesverwaltung fŸr IT-VertrŠge ausgibt, gehen gerade mal zehn Prozent an Unternehmen in Deutschland. Diese Diskrepanz zwischen dem, was man eigentlich will und dem, was man macht, ist so gro§, dass wir uns fragen mŸssen, woran das liegt und wie wir das Šndern kšnnen. Auch hier ist es total wichtig, dass Akteure aus der Forschung und aus der Zivilgesellschaft mit dem Finger nachbohren und fragen, warum es so ist. Wir mŸssen das auf jeden Fall im Auge behalten, da es angesichts der Entwicklung in den USA gerade super wichtig, damit wir uns nicht erpressbar machen mit den Technologien, auf die wir alle jeden Tag angewiesen sind.
Steffen: Lea, Oliver hat gerade auch das Thema Umwelt angesprochen. Das ist auch ein Thema, was im Wahlkampf bislang Ÿberhaupt nicht vorkommt. Das hat natŸrlich sehr viel mit Digitalisierung zu tun. Wie schaust du darauf? Ist das fŸr dich auch und das Common Grounds Forum auch ein Thema mit dem ihr euch beschŠftigt, digitale Themen mšglichst ressourcenschonend anzugehen und zu produzieren? Wir wissen ja alle, um die Problematik, die durch gro§e Rechenleistungen im KI-Training und bei anderen Themen entstehen. Marina, du kannst da sicherlich gleich auch noch was dazu sagen. wie schŠtzt du das Thema ein?
Lea Hildermeier: Das Thema ist definitiv etwas, wo wir auch mit dem Common Grounds Forum drauf geguckt haben. Ich glaube aus genau den GrŸnden, die wir gerade schon besprochen haben. Ich wŸrde nochmal meine spezifischere studentische Brille dafŸr aufsetzen. KI ist ein Riesenthema an den UniversitŠten. In allen Formen und Farben und geht rauf und runter in den Diskursen und Debatten, die da gefŸhrt werden. Auch da interessanterweise, wenn wir auf Beteiligungsprozesse gucken, hŠufiger Ÿber Studierende als mit ihnen. Das ist vielleicht noch ein anderes Problem, was man da bedenken muss. Es wird vor allem auch verwendet. Dann tauchen ganz schnell Fragen auf, wie zum Beispiel: Wenn ich jetzt munter drauflosprompte, was bedeutet das eigentlich auf einer Ressourcenebene? Das finde ich interessant zu fragen, denn aus den Unterhaltungen zu KI an Hochschulen nehme ich wahr, dass Studierende grundsŠtzlich ein Interesse haben, sich damit auseinanderzusetzen und das auch proaktiv nutzen wollen, um sich Wissen anzueignen, um Wissen zu vertiefen und um damit gestŠrkt umgehen zu kšnnen. Das ist aber zum Teil kontrŠr zum Plan der Studierenden, die sich sehr stark fŸr Umweltanliegen einsetzen und das auch schon seit Jahren. Da treffen zwei Pole aufeinander, die gar nicht so einfach miteinander zu verbinden sind. Ich glaube, das liegt unter anderem auch daran, weil die Informationslage dazu sehr schwierig ist und schwierig zu durchblicken ist, besonders aus einer Brille von jemanden, der an der Hochschule unterwegs ist und das einfach mal ausprobieren mšchte, was das auf anderen Ebenen bedeutet. Ich glaube, dass es wichtig ist, kritische Fragen zu stellen, damit es funktioniert und um einen grš§eren Punkt zu verdeutlichen. Das funktioniert, wenn man sich selbst in eine Position bringt, in der man versteht, dass mehrere Faktoren darauf einwirken. Ich glaube, Marina kann da noch mehr zu sagen.
Marina Becker: Ich habe gerade noch mal bei unseren Forderungen des Common Grounds Forums reingeschaut, um diese konkreten Punkte nochmal anzusprechen. Das was Lea gesagt hat gehšrt auf jeden Fall auch zu dem Punkt, den wir Zukunftsgerechtigkeit genannt haben. Das bedeutet, dass man auch bedenkt, dass die LebensqualitŠt zukŸnftiger Generationen durch unser Handeln, das wir heute durchfŸhren, gesichert wird. Solche Aspekte spielen da natŸrlich auch mit rein. Die Verwendung von Ressourcen, ohne darauf zu achten, ist ab einem gewissen Ma§ verantwortungslos und das ist natŸrlich schwierig. Das betrifft nicht nur KI, sondern auch zum Beispiel auch High Performance Computing oder Quantentechnologien, die immer stŠrker zum Einsatz kommen. Andererseits fŠllt es natŸrlich auch unter den Punkt der technischen Sensibilisierung der Gesellschaft, also dass Menschen wirklich verstehen, wie diese technischen Aspekte funktionieren. Als User ist es sehr einfach, irgendwas schnell in Chat-GPT oder in andere Modelle einzutippen. Was passiert aber im Hintergrund? Wie lŠuft das alles? Was sind die Prozesse dazwischen? Wie aufwendig ist das? Da muss mehr Awareness in der Bevšlkerung geschaffen werden Ð das ist sehr wichtig. Dazu haben wir noch einen dritten Punkt: Verantwortungsvoller und transparenter Einsatz von KI in der digitalen Gesellschaft - dazu gehšrt das auch, insbesondere auf der Datenlagen. Wo kommen die her? Wie werden die generiert und verarbeitet? Dazu gehšrt halt auch ein bisschen Transparenz im Prozess Ð was passiert in der KI? Es wŠre natŸrlich super, wenn es generell šffentliche Informationen gŠbe, beispielsweise bezŸglich der Menge an, die bei der Nutzung bestimmter Modelle verbraucht werden.
Steffen: Oliver, kšnnte das ein USP fŸr Parteien sein, wenn sie sagen, dass sie zwar die Digitalisierung der Gesellschaft und der Verwaltung, die Staatsdigitalisierung, vorantreiben, dabei aber auch immer die Umwelt im Auge haben? Welche Ressourcen wir dadurch nutzen, dadurch kšnnte auch ein Wettbewerbsvorteil entstehen. Wir wissen alle, dass die Energiewende beispielsweise auch dafŸr gesorgt hat, dass wieder Gelder in die Innovation von alternativen Energien reingesteckt wurden. Das hei§t also auch, dass das ein Wirtschaftsfaktor sein kann. Ich sehe das gar nicht so. Was mir auffŠllt ist, dass das Parteien in ihre Programme mit aufnehmen. Hast du da was gefunden?
Oliver Bott: Am ehesten ist das bei den GrŸnen so. Was du ansprichst, ist ein mšglicher USP. Wenn man sich jetzt auf die Diskussionen in der Automobilbranche anschaut, sagen diese mit Blick auf die nŠchsten Bundestagswahlen, dass jetzt keine Rolle rŸckwŠrts beim E-Antrieb gemacht werden soll, weil es sie in sehr gro§e Schwierigkeiten bringt - die brauchen Planungssicherheit. Die MobilitŠtswende ist mit riesigen Investitionen verbunden und sie sagen, dass es andere machen, wenn wir es nicht machen - das muss kommen. Von daher kšnnte es ein USP sein. Ist es etwas, was den Parteien hilft, mehr WŠhlerstimmen zu bekommen? Meine BefŸrchtung ist, dass viele Menschen aktuell zumindest, nicht mehr so sensibel dafŸr sind, was das eigentlich bedeutet. Bei Umweltschutz und Nachhaltigkeit, war das vor fŸnf Jahren mit den Protesten, die es gab, anders. Ich habe das GefŸhl, das sich gerade gesellschaftlich eine MŸdigkeit eingestellt hat und das ist natŸrlich auch etwas, das wir mit sehr gro§er Sorge betrachten.
Steffen: Ja, man kšnnte das natŸrlich auch zeigen oder deutlich machen, indem man sagt, alleine fŸr die KI-Trainings von Google wird jetzt ein eigenes Atomkraftwerk wahrscheinlich gebaut werden. Also die sind ja schon dabei. Also, dass auch wenn wir jetzt hier selbst entwickeln wollen und wenn wir selbst quasi in diese Richtung mit einer eigenen KI-Anwendung kommen wollen, wŸrdest du uns die Frage stellen, woher der Strom kommt, oder?
Oliver Bott: Absolut. Ich persšnlich nehme auch eine MŸdigkeit in der Bevšlkerung wahr, was aber nicht hei§t, dass es kein wichtiges Thema ist. Es ist auch der Energieverbrauch von Apps, die Tracking gegenŸber denen zugelassen haben, die ohne Tracking funktionieren untersucht worden - die ohne Tracking verbrauchen einen Bruchteil der Energie. Allein diese Logiken muss man verstehen. Das wŸrde uns schon sehr helfen. Diese Daten, Ÿber die wir jetzt gerade gesprochen haben, sind extrem schwer zu bekommen. Viele Unternehmen sind sehr zurŸckhaltend mit dem, was sie šffentlich machen. Das macht es schwer, darŸber zu sprechen, dabei wŠre es gut, wenn wir es hŠtten. Auch da ist wieder die Frage, wie Regulierung da helfen kann. Ich glaube, man mussÉ
Steffen: Ja.
Oliver Bott: É man muss Druck aufbauen, sonst wird sich wenig Šndern. Die Geschichte der letzten Jahre zeigt, dass Selbstverpflichtung, die in den USA bisher sehr beliebt ist und eingefordert wird, uns das nicht so richtig weiterhilft.
Steffen: Das eine ist Regulierung oder Selbstregulierung, das andere ist Engagement. Das hei§t, dass wir uns engagieren kšnnen. Das Common Grounds Forum engagiert sich. Ihr habt ja einen Forderungskatalog aufgestellt. Lea, wie kriegt ihr mehr Output aus eurem Engagement? Wie versucht ihr dort etwas zu bewirken? Was sind da eure Strategien, da wirklich auch mit durchzudrŠngen? Das ist ja oft das gro§e Problem dabei. Damit wir auch nicht zu dem Satz kommen: ãIch kann ja reden, was ich will, aber es Šndert sich ja sowieso nichtsÒ. Den mšchte ich tun nichts vermeiden, aber ich habe ihn jetzt ausgesprochen. Das tut mir leid.
Lea Hildermeier: Ich glaube, da gibt es mindestens zwei Antworten auf diese Frage. Die eine ist Sichtbarkeit. Die ist zum Teil gar nicht so einfach zu erlangen. Wenn ich Sichtbarkeit sage, meine ich damit das, was ich eingangs schon angesprochen hatte und was man so beispielhaft an der Teilnahme am Digitalgipfel ableiten kann. Wer ist denn auf dem Digitalgipfel? Wen trifft man denn da? Grš§tenteils tatsŠchlich eher nicht die jungen Leute, wenn wir mal ehrlich sind. Was aber gebraucht wird, sind diese jungen Leute auf diesen Plattformen, weil sonst einfach ein Gro§teil einer Perspektive fehlt - die geht komplett verloren in der Unterhaltung. Das meine ich mit Sichtbarkeit. Das ist aber vielleicht eher der zweite Schritt, weil es vor der Sichtbarkeit Ÿberhaupt Mšglichkeiten zum Vernetzen und zum Austauschen geben muss, um die Expertise junger Menschen anzuerkennen und aktiv mit einzubringen. Da ist es super, wenn es moderierte Plattformen oder moderierte Gruppen, die das schaffen kšnnen. Eine dieser Forderungen war unter anderem auch mehr Debattenkompetenz, die wir zum Beispiel mit dem Common Grounds Forum aufgestellt haben. Das zeigt sich exemplarisch, wenn wir Ÿber Digitalisierung reden. Zum Teil wird in den Schulen immer noch gefordert, dass SchŸler-Innen AufsŠtze Ÿber pro und contra zu Schuluniformen auf gefŸhlt 500 Seiten schreiben, mšchte ich mal Ÿberspitzt sagen. Anstatt vielleicht zu Ÿben, wie ich mich kondensiert in einem Post zu aktuellen Debatten wie zum Beispiel zu KI positioniere, der mir Social Media-mŠ§ig nicht mehr als 300 Zeichen gibt. Es gibt einen gro§en Drift zwischen dem, was in Schulen, zum Teil auch Hochschulen passiert und dem, was junge Menschen tatsŠchlich interessant finden und wo sie sich auch einbringen mšchten. Das hei§t, dass das Sichtbarmachen und sich dadurch ein starkes Netzwerk aufbauen zwei Antworten sind.
Steffen: Die Debattenkultur ist noch mal ein gutes Stichwort, Oliver. Wenn wir Ÿber die Digitalisierung der Verwaltung reden, reden wir nicht nur Ÿber digitale Services, also e-Government Services, sondern auch darŸber, wie wir Debatten in diesen Vorgang mit einbringen kšnnen. Es geht darum, wie wir die BŸrgerinnen und BŸrger stŠrker mit einbeziehen, damit sie das GefŸhl haben, dass sie etwas aktiv mitgestalten kšnnen. Es ist wichtig, weil durch Gestaltung auch Selbstwirksamkeit entsteht. Siehst du da irgendeine Entwicklung in Deutschland, dass digitale Technologien eine bessere Debattenkultur ermšglichen?
Oliver Bott: Ich kann es jetzt an den Wahlprogrammen zum Thema Partizipation und BŸrgerbeteiligung konkret machen. Das ist interessant, wenn man sich das anschaut. Wenn man die Wahlprogramme der Union oder der FDP durchsucht, findet man nichts. Es gibt keine ErwŠhnung der Begriffe Beteiligung oder Partizipation. Das ist bei der SPD und den GrŸnen anders, denn die sagen, dass eine Beteiligung wichtig ist. Die SPD wŸrde gerne mehr BŸrgerforen einrichten und digitale Plattformen ausbauen, die es schon gibt und wo man sich einbringen kann. Die sprechen von kommunalen EntwicklungsbeirŠten und auch BŸrgerrŠten. BŸrgerrŠte fordern Ÿbrigens auch die GrŸnen Ð auch denen ist BŸrgerbeteiligung wichtig. Wir haben vorhin von einem neuen Ministerium gesprochen. Auch die Linke Partei mšchte ein neues Ministerium bauen, beziehungsweise einrichten - ein Ministerium fŸr Migration und Partizipation. Auch denen ist das Thema wichtig. Bei Volt ist es Šhnlich, das ist bei denen in der DNA. Mit Blick auf die nŠchste Regierung, wŠre es ein mšglicher Streitpunkt, wenn die Union etwas zu sagen hat. Ich glaube, dass es mit den mšglichen Koalitionspartner-Innen sehr interessant wird, ob sich da etwas tut. Ich habe den Eindruck, dass die CDU/ CSU nicht so erpicht darauf ist, wobei ich jetzt Ÿberhaupt nicht ausschlie§en will, dass sie das auch machen wŸrden. Ich glaube aber, dass es ein Punkt ist, wo mich diese Lehrstellen in den Wahlprogrammen etwas Ÿberrascht haben.
Steffen: Ja, nicht nur dich, sondern uns alle. Da ist es wahrscheinlich nicht so Ÿberraschend, weil wir wissen, dass auch hier wiederum sehr hŠufig Symbolpolitik stattfindet. Marina, was kšnntest du dir vorstellen, wie wir Debattenkultur und Digitaldebattenkultur in Deutschland verbessern kšnnten? Was wŸnscht du dir? In welchem Biotop wŸrde das besser funktionieren, dass man nicht nur die junge Generation, sondern die ganze Gesellschaft besser hšrt, ohne dass es zu einem Riesengebilde kommen muss, was man dann nicht mehr hŠndeln kann.
Marina Becker: Das ist eine sehr gute Frage. Man sollte generell aktiver auf die BŸrger zugehen - auf alle Altersgruppen, je nachdem, auf welchen Plattformen sich die jeweilige Kohorte tummelt. Dass strategisch mehr auf soziale Medien gesetzt wird, sei es mit Beteiligungsprojekten oder Umfragen, oder auch durch Formate, die die Personen wirklich ansprechen. In dem Kontext ist auch Gammification oft ein Begriff. Man lockt die Leute quasi auf spielerische Art an und bringt sie dazu, sich mehr einzubringen Ð vielleicht Konzepte fŸr BŸrgerbeteiligung oder Umfragen in sozialen Medienstaaten mit irgendwelchen Spielen beispielsweise. Was ich neulich erlebt habe und sehr interessant fand, war das Orbis Tool, das die EU gerade als Forschungsprojekt entwickelt. Das ist etwas fŸr die digitale Teilhabe. Es war auch so, dass wir als CEPS Young Thinkers jeder einen politischen Kommentar verfasst haben und in dem Zuge dieses Tool eingesetzt wurde. Da wurde dann mit KI noch einmal zusammengefasst, was die pro-und-contraPositionen sind, sodass es Ÿbersichtlich gegliedert ist. Das was wŠre in vielen Diskussionen hilfreich.Von den einzelnen Personen werden die Positionen aufgenommen und klar gestellt, ohne dass es ein gro§es Durcheinander gibt oder keiner mehr wei§, wer was gesagt hat. So entstehen hŠufig MissverstŠndnisse oder man kommt einfach nicht weiter. Im Grunde genommen sind es gute Tools und gute Strategien, die alle BŸrger mitnehmen.
Steffen: Dass sie auf der einen Seite nicht nur im Output wirken, sondern auch in der Gruppe selbst, die sich beteiligt. So dass sie das GefŸhl hat, ihr Input hat jetzt auch wirklich etwas gebracht. Ich nenne mal ein Beispiel, ohne zu tief in dieses Thema reinzukommen: Neue Migrationsgesetze und Migration insgesamt - wie gehen wir damit um? Dass in einem BŸrgerbeteiligungsverfahren zu diskutieren, online oder digital, wŠre natŸrlich auch gefŠhrlich, oder?
Marina Becker: NatŸrlich, Gefahren lauern Ÿberall. Man mŸsste dann regulierend eingreifen und auch die Antworten filtern, die Leute abgeben, beziehungsweise nachverfolgen, ob da auch Bots mitwirken. Ich glaube aber, dass es gerade in diesem Bereich mittlerweile Technologien gibt, die das gut abfangen kšnnen - Botnetze beispielsweise oder alles, was sehr polarisierend ist. Ich denke, dass wir da ganz gut aufgestellt sind, um soetwas abgefangen zu kšnnen. Aber es gibt sicherlich viele Stimmen, die trotzdem nach wie vor nicht gehšrt werden und wo es wichtig wŠre, dass sie mehr PrŠsenz bekommen.
Oliver Bott: Ich wŸrde auch davon ausgehen, dass es wahrscheinlich schon jetzt Technologien gibt, die eine zivilisierte Diskussion ermšglichen. Worum ich mir eher Sorgen mache, ist nicht der Abstimmungsprozess selbst oder der Partizipationsprozess, sondern alles, was vorgelagert ist, weil wir in einer Zeit leben, wo es Ÿberhaupt nicht so einfach ist, sich zu informieren. Desinformation und Fake News sind Themen, die auch in vielen Wahlprogrammen erfreulicherweise als ernstzunehmendes Problem anerkannt werden. Neben Bots, die solche Diskussionen beeinflussen kšnnen, ist es aktuell extrem schwierig, sich eine Meinung zu bilden. Es ist relativ einfach Ÿber Desinformationskampagnen und Ÿber die Mechanismen der gro§en Plattformen zu sprechen. Da sind wir jetzt auch wieder bei den aktuellen Entwicklungen in den USA Ð es ist sehr einfach diese Diskussion zu beeinflussen. Von daher Steffen, teile ich deine Besorgnis.
Steffen: Lass uns zum Abschluss noch einmal positiv in die Zukunft schauen. NatŸrlich die obligatorische Frage: Was wŸnscht ihr euch fŸr die Zukunft bei den Themen Digitalisierung und digitale Politik? Marina, mšchtest du beginnen? Was sind deine WŸnsche?
Marina Becker: Generell wŸnsche ich mir klare Positionen, die auch umgesetzt werden. Information ist ein gro§es Thema. Es mŸssen die Gefahren von KI und neuen Technologien beachtet, mit eingepriesen und wirksame Methoden entwickelt werden, die wirklich etwas bewirken. Falls ein neues Digitalministerium kommen sollte, wŸrde ich mir auch wŸnschen, dass es die entsprechenden Kompetenzen hat, dass dort idealerweise mehr deutsche Technologien eingesetzt werden, was Oliver vorhin auch angesprochen hat. Ich glaube, das war es auch erst mal.
Steffen: Lea, was sind deine WŸnsche?
Lea Hildermeier: Ich glaube, dass unser GesprŠch gezeigt hat, dass Digitalisierung nicht als Selbstzweck funktioniert. Es kann aber ein gutes Werkzeug sein, wenn wir vernŸnftig damit umgehen - das wŸnsche ich mir, dass wir Digitalisierung als Werkzeug als Werkzeug fŸr partizipative Prozesse verstehen, die uns ermšglichen, verschiedene Menschen an Diskussionen teilhaben lassen zu kšnnen. Und ich wŸnsche mir auch, dass wir die anstehenden Wahlen als eine Chance verstehen, unsere Stimmen einzubringen. Nicht nur zur Digitalpolitik, natŸrlich auch das, aber zu allem, was uns wichtig ist und die Chance auch nutzen, die uns geboten wird.
Steffen: Sehr wichtig. Olli, wŸnschst du dir ein Digitalministerium?
Oliver Bott: Wenn es dann auch gut funktioniert, gerne, ansonsten bitte eine andere Lšsung. Ja, was wŸnsche ich mir? †bergeordnet ist es total wichtig, dass wir eine viel konstruktivere Debattenkultur entwickeln. Nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch im Bundestag. Dass wir wieder lernen, mehr aufeinander zuzugehen und Kompromisse aufzufinden. Ich glaube, das wird total entscheidend, um auch die Menschen mitzunehmen und Lust auf VerŠnderung zu machen Ð mit Blick auf diese vielen Digitalaspekte, Ÿber die wir gesprochen haben. Ich glaube, ein Grund, warum die Politik das Thema bisher in der RealitŠt doch nicht so richtig priorisiert hat, ist, weil es ein Thema ist, mit dem man in der Vergangenheit nicht so viel gewinnen konnte. Wenn wir mit Politiker-Innen sprechen, sagen sie, dass es wichtig ist, aber ihnen nicht mehr WŠhlerstimmen bringt. Eigentlich mŸssen wir Lust auf VerŠnderungen machen. Wir mŸssen zeigen, dass BŸrokratie etwas ist, das man nicht nur abbauen muss, sondern es wichtig fŸr uns ist. Wir mŸssen zeigen, dass es auch in der šffentlichen Verwaltung viele Menschen gibt, die super Arbeit machen und die auch Lust haben, anders zu denken, zu experimentieren und eine bessere Fehlerkultur zu entwickeln. Da reicht es nicht, Gesetze zu verabschieden oder neue Ministerien zu grŸnden, sondern den Kulturwandel in der Verwaltung, einen digitalen Kulturwandel in unserer Gesellschaft, anzusto§en. Da braucht es positive Vorbilder und die wŸrde ich mir in der Politik wŸnschen.
Steffen: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Oliver. Das sind natŸrlich gute WŸnsche, die ich nur unterstŸtzen kann. Ich wŸnsche mir natŸrlich auch, dass alle zur Wahl gehen - das ist ganz wichtig. Deswegen sprechen wir Ÿber Themen, die vielleicht gerade nur am Rande diskutiert werden. Ich hoffe, ihr hattet alle Spa§ daran und habt euch gut unterhalten gefŸhlt - ich hatte viel Spa§. Vielen Dank fŸr eure Zeit! Verfolgt den Kanal hier weiter. Ich hoffe, dass noch weitere Folgen kommen werden. Nicht vergessen, alle weiteren wichtigen Informationen findet ihr in den Show Notes - Informationen zu den hier vertretenen Organisationen, Common Grounds, Stiftung Mercator und Politik Digital und natŸrlich auch noch tiefer gehende Links zu Themen, die wir heute hier angesprochen haben. Viel Spa§ dabei und gutes Gelingen.